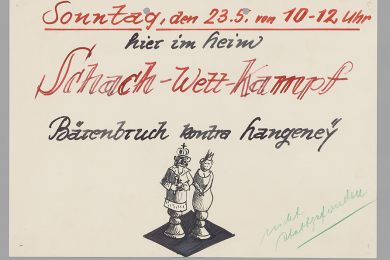Aktuelles
In diesem Bereich finden Sie Beiträge aus den Bereichen Bergbauerbe, Montangeschichte sowie Sammlungs- und Objektforschung. Diese werden Ihnen mit den aktuellen Neuigkeiten aus den bergbaulichen Sammlungen und Museen zur Verfügung gestellt.
Außerdem finden Sie hier den das Objekt des Monats und den Fund des Monats. In beiden Kategorien möchten wir Ihnen anhand eines exemplarischen Objekts aus den Musealen Sammlungen und Beständen des montan.dok etwas über Montangeschichte aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erzählen.
Neue Website des Archivs im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets
Das Archiv als Teil des Hauses der Geschichte des Ruhrgebiets verfügt unter anderem über die Akten des der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie (IG BE) sowie über zahlreiche weitere Bestände zur Montanregion Ruhrgebiet. Hinzu kommt ein Spezialbestand an Objekten im Umfeld des IGBE-Archivs. Mit dem
Kinder-Paradeuniform aus dem Erzgebirge
Kabinett-Ausstellung in Schloss Burgk
Vor 20 Jahren eröffnete auf dem Gelände der Städtischen Sammlungen Freital auf Schloss Burgk eine nachgebildete Schachtanlage der SDAG Wismut, die die Gewinnung und Aufbereitung uranerzhaltiger Steinkohle bis 1989 thematisierte. Unter dem Titel „… und auf dem Schacht ein roter Stern…“ erinnern die Städtischen
Wer ist eigentlich Max? Und warum brauchte er Wasser?
Ausstellung zu Kunst und Kohle
Das Centre Historique Minier in Lewarde präsentiert unter dem Titel „Au charbon. Pour un design post-carbone“ vom 21.06.2025 bis 25.05.2026 eine Sonderausstellung mit 40 Werken aus den Bereichen Kunst, Design und Architektur, die sich mit dem Material „Steinkohle“ befassen. Im Zentrum steht die Rolle von
Lilien zwischen Koks und Kohle – Kokereidirektor mit ungewöhnlichem Hobby
Ikonografie des Todes – Darstellungen zum Lebensende in der Grafiksammlung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum
Ob man dem Gedanken an das Lebensende humorvoll, gelassen, besorgt, mit Unbehagen oder überhaupt begegnet, ist individuell und bisher wenig erforscht. In der Bildenden Kunst ist die Visualisierung des Todes hingegen seit der Antike ein gängiges und wiederkehrendes Sujet, welches Aufschluss über zeitgebundene Vorstellungen dazu gibt. Wie aber hält man in einem Bild etwas fest, was man nicht sehen kann?
Bergbaumuseum Bexbach erhält Förderung
40.000 Euro erhält der Trägerverein des Bergbaumuseum Bexbach durch das saarländische Kultusministerium. Der 1993 zur Erhaltung des Museums gegründete Verein ist damit auch weiterhin in der Lage, die lange Bergbaugeschichte Region darzustellen und die umfangreichen Ausstellungen in den fünf Stockwerken des
Fördergemeinschaft für Bergmannstradition lässt Grubenwagen sanieren
Mit Unterstützung der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition linker Niederrhein konnten zwei in die Jahre gekommene Grubenwagen zum 75-jährigen Stadtjubiläum generalüberholt werden. Im Zentrum Kamp-Lintforts erinnern Sie unter freiem Himmel an die Bergbaugeschichte des Ortes. Weitere Informationen finden