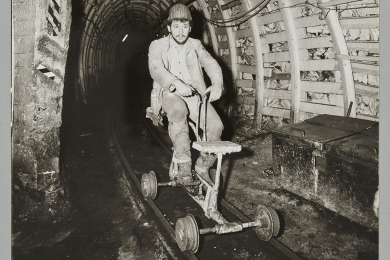Fund des Monats
Gesucht und nicht gefunden – Heinrich Moshages Barbara-Plastiken im Auftrag des Deutschen Bergbau-Museums Bochum
Die Heilige Barbara gehört heute im Ruhrgebiet zum Bergbau wie der Sand an den Strand. An der Popularisierung der Heiligen als Schutzpatronin der Bergleute im Rheinisch-Westfälischen Steinkohlenrevier trug der Gründungsdirektor des heutigen Deutschen Bergbau-Museums Bochum, Dr.-Ing. Heinrich Winkelmann (1898-1967), maßgeblich bei. Kein Wunder also, dass es in den Musealen Sammlungen eine Vielzahl an Grafiken, Gemälden, Zeichnungen, Plastiken und Gebrauchsgegenständen mit Motiven der Schutzpatronin gibt. Doch gerade die von Winkelmann in Auftrag gegebenen Bronzeplastiken von Heinrich Moshage (1896-1968) fehlen.